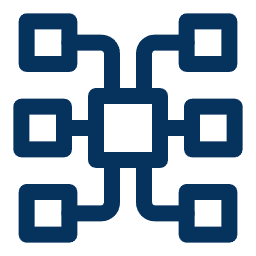SKET-Modeling #2: Warum SKET-Modeling funktioniert
Wie DWH-Modellierung abläuft
Ein gutes Datenmodell stellt geschäftsrelevante Informationen so dar, dass sie verständlich, konsistent und wartbar sind. Als Herzstück der BI-Anwendungen ist ein klares und gemeinsam getragenes DWH-Schema zentral für die Kommunikation und Weiterentwicklung.
In der Praxis begegnet man zwei typische Ausgangspunkte für die DWH-Modellierung. Beide führen in der Praxis häufig zu Modellen, die fachlich unklar und schwer wartbar sind. Dennoch hat sich bislang kein Verfahren etabliert, das diese Herausforderungen systematisch löst.
Quellengetriebene Modellierung
Dieser Ansatz beginnt mit einer Analyse der operativen Systeme. Ziel ist, möglichst viele Datenquellen ins DWH zu laden – in der Annahme, dass die semantische Integration später erfolgen kann. Was zunächst einfach klingt, wird schnell aufwändig: Feldnamen sind kryptisch, Inhalte kaum dokumentiert. DWH-Entwickler müssen die Geschäftslogik aus den Rohdaten rekonstruieren; häufig im Austausch mit Kollegen aus operativen Teams, die selbst keinen Überblick über die Datenbedeutung haben oder keine Motivation, daran mitzuwirken. Zusätzlich erschwert die fachbereichsübergreifende Integration eine kohärente semantische Klärung.
Anforderungsgetriebene Modellierung
Die zweite Methode orientiert sich an klassischen Softwareentwicklungsprozessen: Man erhebt Anforderungen und versucht daraus ein DWH-Modell zu entwickeln.
Das Problem: Anwender können ihren Informationsbedarf meist nicht abstrakt formulieren. Erst konkrete Berichte machen deutlich, was fehlt oder falsch verstanden wurde. Das führt zu einem iterativen Prozess aus Rückfragen, Anpassungen und Korrekturen. Modell und Bericht wachsen gemeinsam, aber ohne konzeptionelle Grundlage. Das führt zu fragmentierten Strukturen, die optimiert sind für spezifische Reports, aber für andere Fragestellungen nicht verwendet werden können. Neue Anforderungen führen zu zusätzlichen, nicht integrierten Datenstrukturen und damit zu einem Modell, das nicht mehr als Ganzes gesehen werden kann.
Was bringt SKET-Modeling an zusätzlichen Nutzen
SKET-Modeling unterscheidet sich von klassischen Modellierungsansätzen weniger in der Methodik als im Zeitpunkt seines Einsatzes. Es setzt dort an, wo DWH-Projekte ins Stocken geraten: nicht am Anfang, sondern mittendrin. Das Modell ist gewachsen, das Reporting funktioniert irgendwie, aber jede kleine Anforderung zieht unverhältnismäßig viel Aufwand nach sich. Das System trägt, aber es trägt schwer.
Genau hier bietet SKET-Modeling einen anderen Blick: Statt weiter an bestehenden Strukturen zu flicken, rückt es die inhaltliche Klärung ins Zentrum und bietet einen strukturierten Zugang zur konzeptionellen Neuausrichtung.
Die Modellierungsbedingungen könnten kaum besser sein: Es gibt Erfahrung, Daten, Berichte und oft erstmals die Zeit, ein Modell nicht unter Projektdruck, sondern mit inhaltlicher Distanz zu entwerfen.
- Die tatsächlichen Anforderungen sind bekannt; sie stecken in den existierenden Berichten.
- Die Quellstrukturen sind erschlossen; sie wurden in ETL-Prozessen umgesetzt.
- Die Beteiligten haben praktische Erfahrung mit den Daten ebenso wie mit den dahinterliegenden Prozessen gesammelt.
SKET-Modeling nutzt diesen Reifegrad. Es schafft die Möglichkeit, sich mit Abstand und Klarheit dem zu widmen, was in der Hektik des Aufbaus oft untergeht: der Bedeutung der Daten.
Was es braucht, damit SKET-Modeling funktioniert
SKET-Modeling lässt sich nicht einfach „einführen“. Es braucht einen Moment, in dem das System reif ist und die Beteiligten offen dafür, das eigene Vorgehen zu hinterfragen. Meist ist dieser Moment dann erreicht, wenn der Aufwand für Veränderungen in keinem Verhältnis mehr zum erwarteten Nutzen steht. Halt machen, zurückblicken und nochmal neu aufsetzen ist ein sehr ungewöhnliches Vorgehen in unserer Unternehmenspraxis, die meist nur ein „Voran“ kennt.
SKET-Modeling ist daher keine technische Entscheidung, sondern ein kultureller Schritt. Es braucht Mut zur Veränderung, Bereitschaft zur Verständigung und die Einsicht, dass fachliche Klärung vor technischer Umsetzung kommen muss. Entscheidend ist, dass das Team und vor allem die Führung erkennt:
Ohne ein klares, gemeinsam verstandenes semantisches Modell wird ein DWH langfristig nicht tragfähig sein.
Wer sich auf diesen Weg einlässt, sollte wissen: Ein konzeptionelles Modell verändert nicht nur die Sicht auf Daten, sondern es verändert, wie im Unternehmen über Daten gesprochen, entschieden und priorisiert wird.
Weiterlesen in meiner Modellierungsreihe:
- Fachliche Modellierung (Teil 4) – Data Vault und des Kaisers neue Kleider?
- SKET-Modeling #1: Warum einfach, wenn es auch schwierig geht
Über die Autorin:
Dr. Katharina Wirtz ist Beraterin mit dem Fokus auf BI, Datenmodellierung und Team-Enablement. Mit ihrer Firma SKET22 hilft sie Unternehmen, datengetriebene Entscheidungen auf ein solides Fundament zu stellen.
Mehr zu ihren Workshops: sket22.de
Vernetzen auf LinkedIn: linkedin.com/in/katharina-wirtz